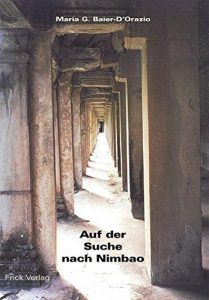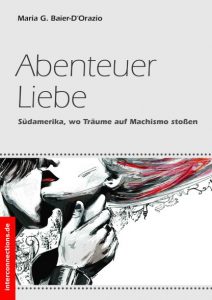Bestellen bei
Frick Verlag
Amazon
Romane
Leserstimmen ...
Weitere Leserstimmen:
„Ich habe Auf der Suche nach Nimbao regelrecht verschlungen und bin so fasziniert, dass ich es kaum zur Seite legen konnte. Ich musste einfach immer weiter lesen… es zog mich wie eine Droge.“
„Ich bin gerade mitten in der Suche nach Nimbao… Die Geschichte ist wirklich fesselnd, die Charaktere außergewöhnlich und die Landschaften malerisch. Ich bin sehr auf das Ende gespannt!“
„Das Buch hat eine geniale, glücklich machende Lösung. Es war auch mit meinem 15-jährigen Enkel ein Erfolg.“
„Musste das Lesen unterbrechen – was bei diesem Buch gar nicht geht. Bin jetzt beim Wüstenvolk und wahnsinnig gespannt wie es weitergeht. Das Buch sollte man verfilmen – es ist so geschrieben das man alles „live“ miterlebt und vor Augen hat – einfach wunderbar!“
Leseprobe ...
Leseprobe aus: Auf der Suche nach Nimbao
Rund und schwer hing der Mond über Ironlobe. Er schien in dieser Nacht größer als sonst und sonderbar rötlicher Schein umgab ihn. Funo-de-nuvo, die Nacht des roten Mondes. Sie bedeutete viel für die Geschicke des kleinen Reiches Ironlobe. Denn in dieser besonderen Nacht kündete der rote Mond von tief greifender Wandlung – einer Wandlung, die dieses Mal jedoch anders sein sollte als sonst, ohne dass dies ein einziger all derer, die in dieser Nacht auf ihn starrten, hätte ahnen können.
(…) Eine Glocke durchdrang mit heller Stimme den Saal, brachte augenblicklich alles Murmeln und Flüstern zum Schweigen. Lautlos öffnete sich eine Türe zur Rechten des Raumes. Herein traten zwei Männer und zwei Frauen in schlichten bodenlangen Gewändern. Die Männer waren in schwarz gekleidet und trugen einen breiten weißen Gurt, die Gewänder der Frauen dagegen waren weiß und wurden jeweils von einem schwarzen Gurt gehalten.
Gemurmel erhob sich, noch während die vier zur Mitte des Saales schritten, um sich dort auf den marmornen Sitzen niederzulassen: Vier? Warum kamen sie nur zu viert? Wo war das fünfte Ratsmitglied?
So manche Stirn umwölkte sich –.
Noch nie in der Geschichte Ironlobes war es vorgekommen, dass die Mitglieder des Rates in dieser Nacht nicht vollzählig erschienen wären.
Die Glocke ließ ein zweites Mal ihren reinen Klang vernehmen. Das Gemurmel erstarb wieder. Stille breitete sich aus im Saal. Und es war als breitete sie sich über das ganze Land aus, bis in die entferntesten Winkel hinein, als erfülle sie die Nacht mit atemloser, banger Erwartung.
„Verehrter Herrscher“, begann Saratu, der Älteste des Rates, indem er sich erhob und zu Wurozu, dem Herrscher von Ironlobe emporsah, der über ihm an der Nordseite des Saales thronte, „Brüder und Schwestern von Ironlobe, wir begrüßen Euch in dieser besonderen Nacht. Ihr seid hier zusammengekommen, um heute zu erfahren, wen der Hohe Rat auserwählt hat für das Amt des Sinterondo in unserem Reich. Jeder von uns weiß, wie wichtig diese Nacht für unser Reich ist. Doch wie Ihr seht, sind heute nur vier von uns unter Euch –.“
Die Versammelten beugten sich unwillkürlich in ihren Sitzen vor. Kein Laut war zu vernehmen. Hunderte von erwartungsvollen Blicken hatten sich an seine Lippen geheftet. Saratu sah in die Runde.
„Towa, unser fünftes Mitglied liegt mit einer schweren Krankheit darnieder. Er ist nicht mehr Herr seiner Sinne – .“
Die Spannung im Saal stieg. In den Herzen machte sich ungute Ahnung breit. Was bedeutete das? Was war es, das jeden Atemzug in nie gekannte Beklemmung einschnürte? Freilich war es ungewöhnlich, dass der Hohe Rat bei der Verkündung der Wahl nicht vollzählig war, doch das allein konnte es nicht sein! Denn der Hohe Rat hatte sich, stets lange vor der Nacht des großen Mondes, auf denjenigen geeinigt, der Sinterondo werden sollte, stellte dies doch die vornehmliche Aufgabe des Rates dar. Da das Erscheinen des roten Mondes niemals vorherzusehen war, musste der Hohe Rat stets darauf vorbereitet sein – so wollte es die Tradition Ironlobes.
„Nun, ich muss Euch verkünden –“, Saratu holte tief Luft, man merkte ihm an, wie schwer ihm die Worte fielen, „ – dass sich der Hohe Rat diesmal außerstande sah, seine Aufgabe zu erfüllen.“
Betroffenes Schweigen im ganzen Saal. Es war als hielte die Stille selbst den Atem an. Diese Nachricht musste erst einsinken in die Herzen der Menschen.
Außerstande –.
Sie hatten es vernommen, dieses Wort, das den Raum durchschnitten hatte wie die todbringende Klinge eines Schwertes. Sie hatten es vernommen, ja, doch niemand wollte es wahrhaben. Die verzweifelte Hoffnung hunderter von Herzen bäumte sich auf gegen den unerwarteten Todesstreich, beschwor die in alten Liedern besungenen Zauberformeln vergangener Zeiten, die Gesprochenes ungesprochen, Krankes heil – Totes lebendig werden lassen konnte…
„Der Hohe Rat sieht sich außerstande? Ehrwürdiger Saratu, wie kann das sein?“
Eine Stimme durchdrang die Stille, die gleichwohl keine Stille mehr war, da doch tausend stumme Fragen die Luft erfüllten. Ninida, die letzte Sinterondo des Reichs der Monde, die unter den Versammelten weilte, hatte sie gestellt.
„Der Hohe Rat sieht sich außerstande“, eine der beiden Frauen des Rates stand auf zu antworten, und ihre Antwort währte nicht länger als die Zeit, die sie brauchte, um sich zu erheben, „weil es zwei Männer gibt, die beide gleich gut geeignet erscheinen und der Hohe Rat sich nicht auf einen einigen konnte.“
„Der Hohe Rat konnte sich nicht einigen? Wie ist das möglich, da es doch einzige Aufgabe des Rates ist, stets Ausschau nach dem zu halten, der für die Nacht des großen Mondes auserkoren ist! Dreimal zehn Jahreszeiten hat der Hohe Rat Zeit gehabt und trotzdem hat er sich nicht entscheiden können?“ Ungläubigkeit schwang in Ninidas Worten.
Und in der Tat, sie hatte Recht: dreimal zehn Jahreszeiten war es her, als sie ihr Amt als Sinterondo nach den fünf Jahreszeiten, in denen ein Sinterondo regierte, an Saona abgegeben hatte. Dreimal zehn Jahreszeiten war eine lange Zeit, in welcher der Rat sich längst auf jemand hätte einigen müssen.
„Es ist richtig, was Ihr sagt, ehrwürdige Mutter Ninida“, nachdenklich ließ Saratu den Blick über die Versammelten schweifen, seine Worte waren schwer wie die Bürde, die er in diesem Augenblick trug, „doch war diesmal alles ganz anders als es uns die Überlieferung aus der Geschichte unseres Landes berichtet. Nachdem Ihr, ehrwürdige Mutter, Euer Amt abgegeben und uns eingesetzt hattet, da vergingen kaum einige Jahreszeiten und wir hatten uns auf einen klugen, tapferen Mann geeinigt, der außergewöhnlich genug erschien, um für die besondere Aufgabe des Sinterondo bereit zu stehen. Doch dann, vor wenigen Monden erst, geschah etwas, das wir selbst nicht zu verstehen imstande sind. Es war am Tage unserer fünften Zusammenkunft, da wir, Molu und ich, die Vertreter von Nord- und Westregion, mit dem Gedanken nach Kudumu kamen, einen anderen Mann vorzuschlagen: einen jungen Mann aus dem Norden. Schon seit geraumer Zeit hatten wir ihn beobachtet und wir hielten ihn bald für geeigneter als den anderen, die Aufgabe eines Sinterondo zu erfüllen. Denn wir erkannten mehr und mehr, dass sich die Zeiten gewandelt hatten, dass diese Aufgabe nicht nur einen klugen Geist und große Tapferkeit erforderte, sondern viel mehr als das. Ironlobe kann nur durch einen besonderen Mann, eine besondere Frau gerettet werden. Zu groß ist die Herausforderung, und es wird sie nur jemand meistern können, der anders ist, der neue, ungewohnte Wege zu gehen vermag. Wir kamen also nach Kudumu und wollten dies dem Rat vorschlagen. Nachdem wir aber gesprochen hatten, mussten wir erfahren, dass Sawa und Alenatu, die Vertreterinnen aus der West- und der Südregion“, er wies auf die beiden Frauen hinter sich, „ebenfalls einen anderen vorschlagen wollten, und zwar einen jungen Mann aus dem Süden – ein Mann aus dem Haus der Väter.“
Stille folgte diesen letzten Worten.
Das Haus der Väter – das war ein Zauberwort für sich.
In alten Zeiten war es das Herz des Reiches gewesen, ein Ort, der damals gleichgesetzt wurde mit Weisheit, Wissen und geheimen Kräften. Im Lauf der Zeit aber hatte das Haus der Väter für viele seinen Zauber verloren. Es war sogar soweit gekommen, dass man es zerstören wollte, weil man es als einen Hort der schwarzen Magie ansah. Zu jener Zeit war es, da der rote Mond das letzte Mal erschienen war – zu jener Zeit war es auch, da Ninida ihr Amt angetreten hatte: Ninida, die das Haus der Väter vor der Zerstörung bewahrt hatte. So sahen denn nun auch in diesem Augenblick alle auf sie.
Doch Ninidas Miene verriet ihre Gedanken nicht.
„Ich verstehe, dass es so gekommen ist“, sagte sie, „wenngleich dies höchst ungewöhnlich ist in der Geschichte Ironlobes. Doch ich vermag nicht zu verstehen, wieso der Hohe Rat dann nicht versucht hat, sich auf einen der beiden zu einigen.“
Saratu schüttelte den Kopf. „Oh, wir haben es versucht, doch es war uns unmöglich. Molu und ich konnten uns nicht mit jener Gewissheit, die wir verspüren müssen, für den Mann Sawas und Alenatus entscheiden, und diese wiederum verschlossen sich jenem, den wir erwählt hatten. Zwar hatte Towa sich für uns entschieden“, Saratu warf einen kurzen Seitenblick auf die beiden Frauen, die mit reglosen Gesichtern seiner Rede folgten, „doch wie Ihr wisst, kann es bei der Wahl des Sinterondo niemals geteilte Stimmen geben. Es kann der eine oder der andere sein, den man erwählt, doch stets müssen es alle Mitglieder des Hohen Rates zusammen sein, die für ihn stimmen.“
Im Saal wurde es lauter, die Spannung des ersten Augenblicks war gewichen. Wenn auch niemand so recht glücklich war über den Verlauf der Dinge, so hatte sich die Lage doch unversehens in eine Richtung entwickelt, der alle zu folgen vermochten: zum Entweder-Oder, zum ja-nein, zu einem Streit, der nur zugunsten des einen oder des anderen ausgehen konnte. Denn – und daran zweifelte niemand im Saal – schlimmer als die Tatsache, zwei Anwärter zu haben, wäre es gewesen, wenn der Hohe Rat gar keinen gefunden hätte. So nämlich würde es eine Lösung geben, wenn auch niemand derer, die solches dachten, zu sagen gewusst hätte, wie denn nun diese Lösung auszusehen hätte und – wer sie finden sollte.
Video ...
Weiteres ...
Bestellen bei
interconnections-Verlag
Amazon
Abenteuer Liebe
Südamerika, wo Träume auf Machismo stoßen
Die Geschichte einer interkulturellen Liebe
Ein Buch für die,
die spannende Romane lieben,
die sich für Südamerika oder für andere Gesellschaftssystem interessieren,
die – trotz allem – an die Liebe glauben,
die auch die Herausforderungen interkultureller Beziehungen kennenlernen möchten,
die Beziehung als Chance zu persönlichem Wachstum verstehen.
Leserstimmen ...
Weitere Leserstimmen:
„Ich war gefesselt von dem Buch. Es war spannend von Anfang bis zum Ende. Die Sprache ist fantastisch. Es hilft, Machismo zu verstehen. Der fast philosophische Hintergrund zu Liebe und Beziehung begeisterte mich.“
„Der Roman ist richtig gut geschrieben. Er macht Laune, sich damit auf die Wiese oder an den Strand zu legen und sich völlig in diese Welt hineinzubegeben!“
„Ich bin Ekuadorianerin, habe das Buch nicht mehr aus der Hand legen können: Genauso ist es in unserem Land. Die Männer sind so, alles stimmt.“
Leseprobe ...
Leseprobe aus: Abenteuer Liebe
Sie hatten ihre kleine Reise fortgesetzt, von Otavalo nach Süden hin, zur alten Stadt Cuenca, in deren Nähe sich die Ruinen von Ingapirca befinden. Zu diesen Ruinen waren sie unterwegs.
Der Bus schaukelte und rumpelte die steinige Straße entlang, die einem Feldweg weit mehr glich als einer Landstraße. Alle paar Minuten hielt er an, um in Ponchos gehüllte, schweigende Indios einsteigen oder ebenso in Ponchos gehüllte, schweigende Indios wieder aussteigen zu lassen. Manchmal quiekte das Schwein, das sie mit sich führten, oder es schlug das Huhn im Sack gackernd mit den Flügeln. Das waren oft über lange Zeit hinweg die einzigen Geräusche im Bus, das Scheppern und Quietschen des Fahrzeuges selbst ausgenommen.
Mit reglosen Mienen saßen die Männer und Frauen auf ihren Sitzen, schweigend zum Fenster hinaus starrend, den Hut tief in die Stirn gedrückt, und wenn sie doch einmal miteinander redeten, geschah es leise tuschelnd, so dass niemand hören konnte, was sie sagten.
Von der Ortschaft, in der der Bus wendete, um zurückzufahren in die Stadt, war es noch ein kurzes Stück zu Fuß bis zu den Mauerresten des alten Inka-Tempels, die sich unweit vor ihnen majestätisch erhoben. Es hatte zu nieseln begonnen. Die Hände tief in ihren Jacken vergraben, stapften Fernando und Lea hinter ein paar Einheimischen her den Feldweg entlang, der bergauf führte. Der Weg war zu beiden Seiten mit hohen, schlanken Eukalyptusbäumen bestanden, die etwas Schutz boten vor dem Regen.
Vor ihnen gingen ein Mann und eine Frau, offenbar ein Paar. Leas Blick blieb an ihnen hängen. Die Frau, die dicht hinter dem Mann herlief, hatte ein Tuch quer über den Rücken gebunden, in dem nicht wie sonst der Säugling lag, sondern Dinge, die sie vermutlich in der Stadt eingekauft hatten. Mit der linken Hand umklammerte sie einen Sack, der schwer an ihrem Arm zog, mit der rechten Hand trug sie einen Korb, aus dem ein paar Tüten schauten. Quer über der Brust saß, in einer losen Trageschlinge, ein Baby. Der Mann hingegen ging leichten Schrittes und mit leeren Händen vorneweg, sich gelegentlich nach seiner Frau umsehend.
Leas Augen hatten sich an dem Bild festgesogen, als könne sie das, was sie da vor sich sah, durch längeres Hinsehen als Täuschung entlarven. War es tatsächlich möglich, dass der Mann völlig unbekümmert seine Frau hinter sich herlaufen ließ wie einen Packesel?
Da fiel plötzlich aus dem Tuch auf dem Rücken der Frau eine rote Rübe heraus und kullerte ihnen den Abhang entlang entgegen. Fernando bückte sich und hob die Rübe auf. „Hallo, warten Sie mal, Sie haben da etwas verloren!“, rief er und lief den beiden nach.
Sie bezogen es zuerst nicht auf sich, liefen weiter, ohne sich umzudrehen. Dann aber, nachdem Fernando ein paarmal gerufen hatte, wandten sie sich schließlich um. Fernando war nahe an sie herangekommen und hielt ihnen die rote Rübe entgegen, besser gesagt: Er hielt sie dem Mann hin, da dieser ja beide Hände frei hatte. Der Mann strahlte, offenbar erfreut über die freundliche Geste des Städters, als welcher Fernando unschwer zu erkennen war. Auch die Frau strahlte, erfreut darüber, einen Teil des Mittagessens gerettet zu sehen.
„Nimm sie, Frau!“, rief der Mann ihr nun zu.
Lea wollte ihren Ohren nicht trauen und ihren Augen noch weniger als zuvor. Doch der Mann stand tatsächlich da, die Hände untätig herabhängend, strahlte über das ganze Gesicht und forderte seine schwer bepackte Frau, die nun erst Sack und Korb abstellen musste, dazu auf, die Rübe entgegenzunehmen.
Willig folgte die Frau, nichts an ihrer Miene ließ erkennen, dass sie dies ungewöhnlich fand. Sie schien nicht zu erwarten, dass der Mann ihr dabei behilflich war, und es schien sie auch nicht zu stören, dass ihr das Verstauen der Rübe im Tuch auf dem Rücken Mühe bereitete. Schließlich nahm sie Sack und Korb wieder auf, sie dankten beide und gingen weiter ihres Weges. Glücklich, wie es schien.
„Hast du das gesehen?“, fragte Fernando, als sie weitergingen.
„Hm“, erwiderte Lea nur und verfiel in Schweigen. Was hätte sie dazu auch sagen sollen. Sie war noch damit beschäftigt, das Bild zu verarbeiten, das sich ihr geboten hatte, oder besser das, was sich hinter diesem Bild verbarg.
Inzwischen waren sie an die Ruinen herangekommen. Eine weite Anlage erstreckte sich vor ihnen, die zu Inka-Zeiten mit Zirkel und Lineal angelegt worden zu sein schien. Von den meisten Gebäuden und Eingrenzungen sah man freilich nur noch die Grundmauern, doch war auch dies beeindruckend genug.
Ingapirca hatte dem damaligen Inkaherrscher Huayna Capac als religiös-politisches Zentrum gedient. Die Reste des Tempels konnte man nach den gut fünfhundert Jahren ebenso noch bestaunen wie die Reste der übrigen Anlagen und Gebäude: Wohnräume, Bäder, Speicher, Küchen. In einigen Schaukästen waren Keramiktöpfe und Goldarbeiten ausgestellt. Lea und Fernando machten einen Rundgang durch die alten Gemäuer mit den dicken, Ehrfurcht einflößenden Steinquadern, die noch genauso fugenlos und unverrückbar aufeinander saßen wie vor hunderten von Jahren.
Fernando setzte sich auf eine der Mauern und blickte still auf das weite Tal, über das sich in der Ferne Nebel herabzusenken begannen. Lea sah, an die Mauer gelehnt, über die Felder. Ein paar hochbeinige Lamas grasten unweit von ihr. Als sie sich ihnen zu nähern versuchte, hörten sie auf zu grasen, hoben den Kopf und sahen reglos zu ihr her. Bei jedem Schritt, den sie nach vorne tat, wichen die Tiere ein Stück zurück. Nachdenklich sah Lea auf diese Lebewesen, die sie misstrauisch beäugten.
„Was wäre das, was du in deinem Leben niemals verlieren möchtest, Fernando?“, fragte sie unvermittelt, indem sie sich umwandte und zu Fernando aufsah.
Er legte die Stirn in Falten. „Ich glaube, dass es die Freundschaft von Menschen ist – das Vertrauen, das sie zu mir haben“, erwiderte er nachdenklich.
Lea schwieg eine Weile und sah wieder auf die Lamas vor sich. Sie versuchte erneut, sich ihnen zu nähern. Doch nun flohen die Tiere. Dabei stießen sie hohe wimmernde Töne aus, die einem Weinen glichen. Lea sah den sich immer weiter entfernenden Lamas nach.
„Und auf was möchtest du niemals verzichten?“, fragte sie nun, ohne diesmal jedoch zu Fernando hinzusehen.
„Auf die Freiheit.“ Die zweite Antwort war schneller gekommen.
Lea wandte sich um, sah zu Fernando. Er hielt den Blick immer noch in die Ferne gerichtet. Er kam ihr in diesem Augenblick vor wie einer der damaligen Söhne des Inkaherrschers selbst – wie er dort saß, auf der hohen Mauer, aufrecht, mit dem langen dichten Haar und dem starken, stolzen Körper. Aber nein doch, nicht des Inkaherrschers, des fremden Eindringlings aus dem Süden. Waren Fernandos eigene Vorfahren, die Huancavilcas, die Ureinwohner von Guayas, doch selbst starke und stolze Menschen gewesen. Sie hatten die Unabhängigkeit mehr als alles in der Welt geliebt, hatten sich der Fremdherrschaft der Inka nie gebeugt.
Freiheit. Darauf wollten die wenigsten Menschen von der Küste verzichten. Träumer, mit dem nie nachlassenden Drang, Neues kennenzulernen und Unmögliches zu erreichen, das waren sie, die Menschen von Guayas, Manabi, Esmeraldas, den Regionen mit Zugang zum Meer, zur Ferne. Es waren Menschen, die das Leben liebten und die bereit waren, diesem Leben ihr Herz jeden Tag von Neuem zu schenken. Menschen, denen jeder Sinn für Ordnung fehlte und deren Freigebigkeit einen sparsamen Geist zur Verzweiflung und sie selbst an den Rand des Ruins bringen konnte. Doch verlieh diese Freigebigkeit ihrem Leben ein großzügiges Muster, in das man sich weitherzig aufgenommen fand, in dem Platz war zum Atmen und zum Leben. Selbst wenn sie sich inmitten der üppigsten Schönheit blühender Natur befanden, interessierte sie diese nicht im Geringsten. Doch trugen sie, wo immer sie auch unterwegs waren, ihr offenes Herz mit sich, das nahezu ohne Unterschiede jedem seine Freundschaft anbot. Bändigen konnte man sie nicht, und alle Versuche, sie dazu zu bringen, Vorschriften einzuhalten, Schlange zu stehen etwa, Waagen zum Brotverkauf zu benützen oder Taxameter nicht nur einzubauen, sondern auch anzustellen, schlugen erbärmlich fehl. Nicht selten führte dies zu nationalen Reibereien, wurden die Vorschriften doch stets aus Quito diktiert und dort meist auch eingehalten.
Es verwunderte nicht, dass sich die Küstenbewohner mit denen des Hochlandes in vielem nicht näherkommen konnten, war doch der Mensch aus der Welt der Berge einer, der mit beiden Beinen fest auf dem Boden stand, der die Ordnung liebte und fraglos in der Arbeit aufzugehen vermochte, einer, der sich das Sparen zum Lebensinhalt gemacht hatte und seinen Träumen immer wieder neu die Flügel stutzte, um sie an das anzupassen, was sich in der Vergangenheit als dauerhaft bewährt hatte und was in der Zukunft als machbar schien. Er hatte einen Blick für die Schönheiten der Natur, der Bewohner des Hochlandes, bewunderte Berge und Seen, Tiere und Blumen. Und er lobte immerfort den Menschen, wo immer er ihm auch begegnete, schmeichelte ihm, lächelte ihm zu – ‚nein, wie reizend, Sie zu treffen‘, ‚Ich werde Sie auf der Stelle bedienen, mein Herz‘, ‚Aber meine Liebe, selbstverständlich tue ich Ihnen den Gefallen‘. Doch wehe dem, der auf dieses Lob baute, der diesen Worten traute, der gar meinte, in seinem zuvorkommenden Gegenüber einen Freund gefunden zu haben. Nichts ferner als das. Schloss sich die Tür hinter seinem Rücken, konnte der gleiche höfliche Mensch, der soeben ‚mein Herz‘ zu ihm gesagt hatte, wie eine Hyäne über ihn herfallen und ihn mit der gleichen, soeben noch zuckersüß gewesenen Zunge erbarmungslos zerfetzen.
Ein Bewohner der Küste verkleidete seine Gefühle nicht und badete seine Zunge nicht in Honig. Wer ihm gefiel, dem zeigte er es, und wer ihm nicht gefiel, nun, dem zeigte er es auch. Dies konnte bisweilen, vor allem bei den Guayaquilenern, dazu führen, dass sie patzig wurden und grob, dass man den Eindruck hatte, ihnen seien Rücksicht und Höflichkeit höchstens vom Hörensagen bekannt. Doch immer wusste man bei ihnen, woran man war. Man konnte es für verbürgt ansehen, dass sie dann, wenn sie lächelten, ihr Lächeln nicht nur auf den Lippen trugen, sondern dass es wirklich aus dem Herzen kam.
So waren es nicht nur das Klima, die zweitausend Meter Höhenunterschied, eine andersartige Pflanzen- und Tierwelt, die sie voneinander trennte, die Menschen von der Küste und jene vom Hochland: es war ihr Wesen selbst. Wenn aber die Schaffenskraft der einen mit der Phantasie der anderen zusammenkäme, wenn sich die Freiheitsliebe mit dem Sinn für Selbstbeschränkung verbände und wenn das Sparen-Können seine Ergänzung fände in einem großzügigen Herzen – welch eine Zukunft gäbe dies für das Land! Lea lächelte vor sich hin: Noemi, sie war das Ergebnis einer solchen Mischung, mit ihrer Mutter aus Manabi und dem Vater aus Quito.
Lea hatte Noemi vor nicht allzu langer Zeit in einer Buchhandlung kennengelernt, in der diese nach deutschen Büchern gefragt hatte. Lea war dies aufgefallen und sie hatte Noemi angesprochen. Noemi lebte in der Nähe von Cuenca. Lea wollte sie gern besuchen. Noemi war ganz anders als all die jungen Frauen, die Lea bis dahin kennengelernt hatte. Gäbe es heute noch Amazonen, Noemi wäre eine von ihnen. Nein, nicht nur eine von ihnen, sie hätte schlichtweg nur deren Anführerin sein können.
„So wenig habe ich von meiner Heimat gesehen und du lässt es mich erleben. Das werde ich niemals vergessen.“ Fernando sagte es in die Stille hinein. Es klang Stolz daraus und Dankbarkeit. „Setz dich doch zu mir“, forderte er sie auf. Lea ließ sich von ihm auf die Mauer helfen. Still saßen sie da und betrachteten, jeder in seine Gedanken versunken, die altehrwürdige Stätte aus längst vergangenen Zeiten.
„Seltsam, nicht wahr“, bemerkte Lea nach einer Weile, „wie mächtig doch das Reich der Inka gewesen ist und nichts außer ein paar Steinen ist davon übriggeblieben.“
„Dafür haben deine Leute gesorgt“, kam es trocken von Fernando.
„Meine –? Ach so, ja, das stimmt“, lenkte Lea ein. Dann aber fügte sie hinzu: „Vielleicht hätten die Spanier das Land gar nicht erobern können, wenn es nicht in sich zerstritten gewesen wäre.“
Fernando wiegte den Kopf. „Zerstritten? Nun ja, das hiesige Reich von Quito widersetzte sich eben den fremden Herrschern aus Peru, genauso wie die Huancavilcas. War halt unser Pech, dass genau zu der Zeit die Spanier hier auftauchten.“
Was für ein riesiges Reich doch das Reich der Inka gewesen war, das sich, vom peruanischen Cuzco aus, im Süden bis nach Chile hinein erstreckte und im Norden Ecuador mit erfasste. Blühendes Handwerk, ein ausgebautes Verkehrs- und Kommunikationsnetz, eine Landwirtschaft, die bereits die künstliche Bewässerung kannte, ein durchorganisiertes Militärwesen, ein ausgeklügeltes Sozialsystem. Doch was die Kolonisatoren sahen, mit ihren vor Machtgier und Habsucht blinden Augen, das waren kulturlose Wilde. Dabei, so hieß es, habe Francisco Pizarro, der spanische Konquistador, der das Inkareich eroberte, nicht einmal lesen und schreiben können.
Es hatte aufgehört zu regnen. Nun begann es erneut, das leichte dünne Nieseln vom bedeckten grauen Himmel herab. Es zwang sie, den Rückweg zu ihrem Hotel in Cuenca anzutreten. Zwar hatte Noemi Lea zu sich nach Hause eingeladen, doch Lea hatte es für besser befunden, im Hotel zu übernachten. Sie fühlte sich dort freier.
Es war ein durchschnittliches Hotel, obwohl die Zimmer den Luxus aufwiesen, ein eigenes Bad zu haben, einen Teppichboden, ja sogar Fernsehen und Telefon. „Ach, endlich wieder.“ Kaum hatte Fernando die Tür ihres Zimmers hinter sich geschlossen, als er auch schon Lea auf das breite Bett zog.
Und wie immer genügte eine kleine Berührung, um das Begehren anzufachen, um die alles verzehrende Sehnsucht auflodern zu lassen, die übermächtig aufbrach, als fürchtete sie immer noch, das zu verlieren, was sie in Händen hielt. Ein Feuer, das gedämpft werden konnte durch Unstimmigkeiten und Streit, das niedrig gehalten werden konnte, um nicht zu viel von sich selbst preiszugeben, dessen Flammen aber unlöschbar schienen.
Einige Zeit später sah das Zimmer mit dem zerwühlten Bett und den überall auf dem Boden verstreuten Kleidungsstücken aus wie ein Schlachtfeld. „Gehen wir duschen.“ Fernando wälzte sich auf den Rücken und erhob sich. „Was ist das denn?“ Er hatte den Duschvorhang beiseite geschoben und blickte, offenbar recht verwundert, auf das, was sich dahinter befand. Lea trat zu ihm.
„Das ist eine Badewanne, da lässt man Wasser einlaufen und setzt sich dann hinein.“ Fernando bestaunte die Badewanne ausgiebig, er hatte so etwas noch nie gesehen. Kein Wunder, was hätte man im tropischen Guayaquil auch mit einer Badewanne anfangen sollen, schwitzte man an der Küste doch ohnehin genug und pflegten dort nicht einmal die Duschen oder Waschbecken heißes Wasser zu haben. Lea ließ Wasser einlaufen und setzte sich in die Wanne. Erwartungsvoll sah sie Fernando an.
„Soll ich mich da wohl dazusetzen?“ Fernando blickte zweifelnd auf die Wanne. Lea lachte statt einer Antwort. Mit gerunzelter Stirn sah Fernando auf das ungewohnte Behältnis. Schließlich aber überwand er sich und stieg hinein, was die Wanne fast zum Überlaufen brachte.
„Ist ganz nett“, meinte er nach einer Weile, „aber irgendwie ein bisschen verrückt, oder?“ Er sah Lea an, die Stirn immer noch zweifelnd in Falten gelegt.
„Was soll denn daran verrückt sein?“
„Na, dass wir hier zu zweit in der Wanne sitzen.“
Lea schüttelte verständnislos den Kopf. Sie wusste wirklich nicht, was ihn daran so beeindruckte. Fernando schwieg, planschte etwas mit dem Wasser und begann dann, sich und Lea einzuseifen.
Mitten drin hielt er plötzlich inne. Irgendetwas beschäftigte ihn.
„Aber später, ich meine, wenn wir zum Beispiel mal zusammenlebten, verheiratet wären, da würden wir so etwas nicht mehr machen, oder?“ Aus dem kleinen angehängten oder klang Zweifel heraus, und Bedauern.
„Aber natürlich würden wir das dann auch machen – und dann erst recht“, erwiderte Lea.
„Ach – hm.“ Er schien nicht überzeugt.
Mit einem Mal begriff Lea, was er meinte. Offensichtlich betrachtete er das gemeinsame Baden als etwas Exzentrisches, Frivoles, das allenfalls noch Verliebten zugestanden werden konnte, nicht aber Eheleuten. Das Bedauern, das mitgeschwungen hatte, galt dem, was er für schön hielt und was er, wenn es nach ihm ginge, nicht verlieren wollte.
Lea fiel der Artikel ein, den sie einmal gelesen hatte. ‚Grausame Wahrheiten über den Latino-Mann‘ war er überschrieben gewesen. ‚Wenn du die Wahrheit über den Latino-Mann hören willst, dies ist sie: Er ist ein ausgezeichneter Liebhaber, vielleicht der beste auf der Welt, als Ehemann aber ist er eine Katastrophe. Wenn der Latino-Mann heiratet, schwindet seine Liebestollheit rapide, manchmal noch in den Flitterwochen. Er betrachtet von nun an seine Frau als etwas, das es zu achten, zu ehren, ja, sogar zu verehren gilt, fast so wie eine Madonna, mit der er aber nichts mehr tun kann und soll, was ausgefallen ist, frivol und somit sündhaft.‘
Nie hätte sie geglaubt, dass die Worte dieses Artikels, den sie für reißerisch und übertrieben gehalten hatte, sich eines Tages für sie in Fleisch und Blut verwandeln könnten. War es tatsächlich möglich, dass auch Fernando solch unsinnigen Ballast mit sich herumschleppte? Ihr Blick streifte Fernando, der nun, ein seliges Lächeln auf dem Gesicht, mit geschlossenen Augen in der Wanne lag.
Sie öffnete den Mund, um etwas zu sagen, dann aber besann sie sich anders. Wusste sie denn überhaupt, ob es sie jemals wirklich beträfe?